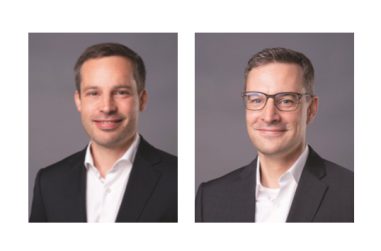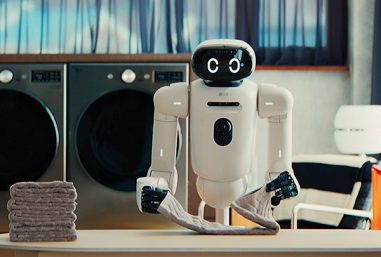Vor dem Hintergrund, dass 2024 rund 4,6 Milliarden Kleinsendungen mit einem Warenwert von jeweils unter 150 Euro aus Drittstaaten in die EU importiert wurden, warnt der ZVEI vor zunehmenden Marktverzerrungen durch internationale E-Commerce-Plattformen und fordert die konsequente Anwendung bestehenden EU-Rechts. Die Zahl der Pakete habe sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 verdoppelt, betonte der Verband. Diese Entwicklung gefährde nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher durch oftmals unsichere Produkte, sondern untergrabe auch die Wettbewerbsfähigkeit regelkonform agierender Unternehmen und konterkariere Umweltziele, da vermehrt Elektroschrott anfalle.
Der Verband plädiert für die rasche Abschaffung der zollfreien Einfuhrgrenze von 150 Euro, eine stärkere Marktüberwachung mit vermehrten Kontrollen sowie die Einführung einer koordinierenden EU-Behörde. „Die rechtlichen Grundlagen sind vorhanden – jetzt müssen sie auch wirksam durchgesetzt werden“, erklärte Maria Marinelli, Bereichsleiterin Consumer im ZVEI. Dabei sollten vor allem Plattformen wie Temu oder Amazon in die Verantwortung genommen werden: Sie müssten sicherstellen, dass angebotene Produkte den EU-Vorgaben entsprechen, Rückrufe bei Sicherheitsmängeln veranlassen und transparente Informationen für Verbraucher bereitstellen, fordert der ZVEI. Zudem sei eine zügige Revision des EU-Zollkodex’ und eine konsequente Nutzung der Instrumente z.B. des Digital Services Acts notwendig.
Ausschlaggebend für einen Kauf bei Temu ist vor allem der günstige Preis. Abstriche bei der Qualität werden offenbar in Kauf genommen: So hat eine repräsentative Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen NIQ GfK im Auftrag des ZVEI im Sommer 2024 durchgeführte, ergeben, dass zwei von fünf der befragten Nutzer schlechte Erfahrungen mit der Online-Plattform gemacht haben. Bei 15 Prozent der Käufer gingen Produkte schnell kaputt und bei jedem zehnten funktionierten sie gar nicht erst.
Ein zentrales Anliegen des ZVEI ist zudem die faire Beteiligung aller Marktakteure an der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR). Derzeit tragen seriöse Hersteller oft die Entsorgungskosten für kurzlebige Produkte mit. Das sei ein Wettbewerbsnachteil, der dringend behoben werden müsse, betonte Marinelli: „Nur durch klare Zuständigkeiten, transparente Prozesse und wirksame Sanktionen lässt sich ein fairer digitaler Binnenmarkt gestalten.” Die Politik müsse bestehende Lücken schließen und die Marktregeln konsequent durchsetzen.